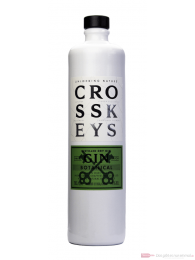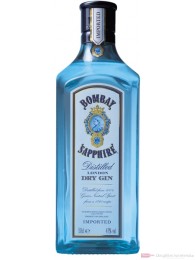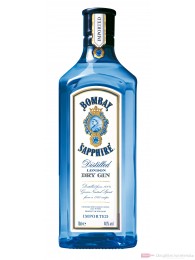-
Deutschlandweiter Versand
pauschal nur 5,9€
-
über 3000 Artikel
warten darauf entdeckt zu werden
-
0172 495 45 05
falls Sie eine Frage haben
Einkaufsoptionen
- Kategorie
-
- 5 Continents Gin
- 5th Gin
- 7d Essential Gin
- Aber Falls Gin
- Adler Berlin Dry Gin
- Aeijst Gin
- Albfink Gin
- Alpako Gin
- Amarula Gin
- Amato Gin
- Amazonian Gin
- Ampersand Gin
- Amuerte Gin
- Applaus Gin
- Aviation Gin
- Barentsz Gin
- Bathtub Gin
- Beefeater Gin
- Bembel Gin
- Berliner Brandstifter Gin
- Biercée Gin
- Black Death Gin
- Black Forest Gin
- Black Forét Gin
- Blackwoods Gin
- Bloom Gin
- Bluecoat Gin
- Blue Ribbon Gin
- Boar Gin
- Bobby`s Gin
- Boe Gin
- Bogart's Gin
- Bols Gin
- Bombay Gin
- Boodles Gin
- Bosford Gin
- Botanic Gin
- Both's Gin
- Bottega Bacur Gin
- Boxer Gin
- Breaks Gin
- Brecon Gin
- Brockmans Gin
- Broker's Gin
- Brooklyn Gin
- Bruderkuss Gin
- Bulldog Gin
- Buss N°509 Gin
- Cadenhead's Gin
- Canaima Gin
- Caorunn Gin
- Cherryblossom Gin
- Citadelle Gin
- Clockers Gin
- Copperhead Gin
- Cruxland Gin
- Cross Keys Gin
- Cubical Gin
- Cucumberland Hannover Gin
- Dactari Gin
- Darnley's Gin
- Death Door Gin
- Del Professore Gin
- Dictador Gin
- Dingle Gin
- Dreyberg Gin
- Drumshanbo Gunpowder Gin
- Eden Mill Gin
- Edinburgh Gin
- Elephant Gin
- Ettaler Gin
- Excellent Gin
- Feel Gin
- Ferdinand's Saar Dry Gin
- Fifty Pounds Gin
- Filliers Dry Gin 28
- Finsbury Gin
- Fords Gin
- Four Pillars
- Francois Dry Gin
- Friedrichs Gin
- Funky Pump Gin
- Garden Shed Gin
- Generous Gin
- Gentle 66 Gin
- Geranium Gin
- German Gin
- Gin'Ca Gin
- Gin Eva
- Gin Gold
- Gin Lane 1751 Gin
- Gin&P Gin
- Gin Mare
- Gin MG
- Ginraw Gin
- Ginstr Gin
- Gin Sound
- Gin Sul
- Gin Xoriguer
- Gin 27
- Gordon´s Gin
- Granit Gin
- Greenall's Gin
- Gretchen Gin
- Gunroom Gin
- G-Vine Gin
- Hammer Gin
- Harrys Waldgin
- Haswell Gin
- Haymans Gin
- Hendricks Gin
- Herbie Gin
- Hernö Gin
- Humboldt Gin
- Hook Gin
- Isle of Harris Gin
- Jaisalmer Gin
- Jinzu Gin
- Jodhpur Gin
- Josef Bavarian Gin
- Junipero Gin
- Killepitsch Gin
- King of Soho Gin
- Ki No Bi Gin
- KM.1 Gin
- Knut Hansen Gin
- Konkani Gin
- Koval Gin
- Kyrö Gin
- Larios Gin
- Law Gin
- Le Tribute Gin
- Libellis Gin
- Liebl Bavarian Dry Gin
- Lind & Lime Gin
- London N° 3 Gin
- Luv & Lee Gin
- Macaronesian Gin
- Mackmyra Gin
- Madame Geneva Gin
- Magellan Gin
- Marcati Gin
- Malfy Gin
- Martin Miller's Gin
- Master's Selection Gin
- Mayfair Gin
- Mermaid Gin
- Milk & Honey Gin
- Minke Irish Gin
- Mit Nig Gin
- MOM Gin
- Mombasa Club Gin
- Momentum Gin
- Monkey 47 Gin
- Mundart Gin
- Naked Gin
- Needle Gin
- Niemand Gin
- Nikka Gin
- Nolet's Gin
- Norden Dry Gin
- Nordés Gin
- Normindia Gin
- Old English Gin
- OMG Oh My Gin
- One Key Gin
- Ophir Gin
- Oxley Gin
- Peaky Blinder Gin
- Pete's Gin
- Pink 47 Gin
- Plateau Gin
- Plymouth Gin
- Poli Marconi Gin
- Puerto de Indias Gin
- Quinta de Ventozelo Gin
- Rammstein Gin
- Red Door Gin
- Reisetbauer Blue Gin
- Roku Gin
- Rutte Gin
- Sabatini Gin
- Saffron Gin
- Sansibar Gin
- Schrödinger's Katzen Gin
- Sears Gin
- Seedlip alkoholfrei
- Siegfried Gin
- Sikkim Gin
- Silent Pool Gin
- Sipsmith Gin
- Sir Edmond Gin
- Six Ravens Gin
- Skin Gin
- Sloane's Gin
- Spitzmund Gin
- Star Trek Gin
- Steinhauser SeeGin
- Stobbe 1776 Gin
- Sturzflug Gin
- Tann's Gin
- Tanqueray Gin
- Tarquin's Gin
- The Artisan Gin
- The Botanical's Gin
- The Botanist Gin
- The Corinthian Gin
- The Duke Gin
- The London N° 1 Gin
- Thomas Dakin Gin
- Tonka Gin
- Triple Peak Gin
- Ungava Gin
- Vallander Pure Gin
- Villa Ascenti Gin
- Von Hallers Gin
- Weissbart Gin
- Whitley Neill Gin
- Whobertus Gin
- Wild Child Gin
- Williams Chase Gin
- Windspiel Gin
- Woodland Gin
- Xellent Gin
- Yu Gin
- Z44 Gin
You're currently on:
Gin
-
Sipsmith Zesty Orange Gin 0,7l
27,99 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=39,99 € / 1 l) -
Sikkim Greenery Gin 0,7l
30,09 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=42,99 € / 1 l) -
Bombay Sapphire Gin 0,05l
4,49 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=89,80 € / 1 l) -
Sikkim Fraise Gin 0,7l
22,19 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=31,70 € / 1 l) -
Tanqueray Alkoholfrei 0.0 0,7l
17,55 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=25,07 € / 1 l) -
Sikkim Bilberry Gin 0,7l
30,49 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=43,56 € / 1 l) -
Hayman's Cordial Gin 0,7l
35,20 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=50,29 € / 1 l) -
Hayman's Exotic Citrus Gin 0,7l
28,98 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=41,40 € / 1 l) -
Gin Mare Capri 0,7l
37,99 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=54,27 € / 1 l) -
Gin Gold 999.9 0,7l
29,99 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=42,84 € / 1 l) -
Whobertus Dry Gin 0,5l
26,49 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=52,98 € / 1 l) -
Star Trek Stardust Gin 0,5l
38,99 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=77,98 € / 1 l) -
Malfy Gin Con Amarena 0,7l
23,69 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=33,84 € / 1 l) -
Cross Keys Gin 0,7l
20,49 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=29,27 € / 1 l) -
Bombay Sapphire English Estate Limited Edition 0,7l
25,62 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=36,60 € / 1 l) -
Hayman's Small Gin in GP 0,2l
32,89 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=164,45 € / 1 l) -
The London No. 1 Original Blue Gin 1,0l
29,13 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=29,13 € / 1 l) -
Sikkim Privee Gin 0,7l
30,69 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=43,84 € / 1 l) -
Bombay Sapphire Gin 0,5l
15,08 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=30,16 € / 1 l) -
Bombay Sapphire Gin 0,7l
18,86 €Inkl. 19% MwSt., zzgl. VersandkostenLieferzeit: 3-4 Tage
(=26,94 € / 1 l)

Gin aus England und dem Rest der Welt
Was den Schotten ihr Whisky oder den Russen und Polen ihr Wodka, das ist den Engländern ihr Gin. Sie wollen einfach nicht auf die Spirituose verzichten – und dabei haben sie das Getränk noch nicht einmal erfunden.
Was ist Gin?
Der Name leitet sich von dem französischen Wort für Wacholder ab. Das macht Sinn, denn Wacholderbeeren sind die einzige für die Herstellung vorgeschriebene Zutat.
Wer ist wann auf Gin gekommen?
Die Wurzeln des Gins liegen beim Genever, der in den Niederlanden von einem Arzt Mitte des 17. Jahrhunderts erdacht wurde. Franciscus Sylvius de la Boe wollte eigentlich ein pflanzliches Heilmittel gegen Verdauungsbeschwerden herstellen und experimentierte mit Rezepten, bei denen ätherische Öle von Pflanzen wie Wacholder mit Alkohol verarbeitet wurden. Was einst als Wundermittel im pharmazeutischen Bereich gelobt wurde, fand Anklang bei den britischen Soldaten und wurde über Umwege in England eingeführt. Der holländische Begriff Genever oder Jenever verwies ebenfalls auf Wacholder als Hauptzutat. Im Englischen nennt sich die Pflanze "juniper". Daraus wurde (auch mit Anlehnung an die lateinischen Wurzeln des Begriffs) schließlich Gin.
Dort nahm man sich der Spirituose auf der Basis von Alkohol und Wacholder an und entwickelte sie im Laufe der Zeit weiter. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts hatte sich der englische Gin in der Bevölkerung so weit verbreitet, dass sich fast jeder seiner Herstellung und seinem Genuss widmete. Gleichzeitig wurde in Amerika immer mehr Getreide angebaut und das führte zu günstigeren Preisen und mehr Rostoffen für die Herstellung. Je mehr englischer Gin produziert wurde, desto minderwertiger wurde seine Qualität. Das wiederum zog einen erhöhten Alkoholkonsum sowie Alkoholvergiftung und andere Auswirkungen nach sich. Eine Krise im 18. Jahrhundert war die Folge. Die Regierung erließ den Act mit Vorschriften, Qualitätskontrollen und hohen Steuern. Dies führte dazu, dass Wacholderschnaps nicht mehr von der Unterschicht, sondern von der Oberschicht genossen wurde.
Allmählich erblühte eine neue Ära, speziell in London. Man feilte an der Destillation und den Zutaten. Typisch englische Ginstilrichtungen wie klassischer, trockener London Dry Gin und süßlicher Old Tom Gin kamen im 18. und 19. Jahrhundert in Umlauf, und sie setzen noch immer hohe Standards. Gleichzeitig etablierte sich der Navy Gin in Großbritannien, da die Briten ihre Marinesoldaten an Bord der Schiffe mit täglichen Rationen versorgten. Navy Strength Gin besaß einen erhöhten Alkoholgehalt aufgrund der Gegebenheiten an Bord. Zwar wurden die Rationen für die Royal British Navy am 31. Juli 1970 (Black Tot Day genannt) eingestellt, doch ein Hersteller darf nach wie vor den authentischen Navy Gin nach alter Rezeptur produzieren.
Davon einmal abgesehen gibt es z. B. noch den Plymouth Gin aus England mit geschützter Herkunftsbezeichnung. London Dry Gin hingegen muss nicht in London destilliert werden, sondern verkörpert eine Ginsorte mit gewissen Regeln und Charaktereigenschaften. Er kann theoretisch überall in der Welt nach diesen Kriterien gebrannt werden. Heute ist der Gin untrennbar mit England verbunden, obwohl es auch holländischen Jenever und Ginsorten aus allen Ecken der Welt zu entdecken gibt. Sie munden pur genauso wie in Cocktails und Longdrinks, beispielsweise als zeitlos attraktiver Gin & Tonic.
Aus was wird Gin gemacht?
Aus was wird Gin gemacht? Die Basis für Gin aus Deutschland oder anderen Ländern ist ein neutrales Destillat aus der landwirtschaftlichen Gewinnung. In fast allen Fällen handelt es sich um ein Getreidedestillat. Es ist theoretisch jedoch möglich, andere Rohstoffe zu verwenden. Man nehme nur einmal den Windpiel Gin und einige Konkurrenten, die sich stattdessen auf Kartoffeln verlassen ‒ oder Marken wie G-Vine, bei denen Weintrauben mit von der Partie sind. Es bleibt der Brennerei überlassen, wie viele Destillationen oder welche Methode genau zum Tragen kommen. Manche bevorzugen eine schonende Dampfdestillation. Die einen geben die aromatisierenden Zutaten direkt in den Brennapparat, die anderen lassen sie in einem Korb ruhen, der die aufsteigenden Dämpfe auffängt.
Kennzeichnend für Gin ist, dass sich eine schier unglaubliche Vielzahl von 120 oder mehr Botanicals für seine Aromatisierung anbietet. Unter einem Botanical versteht man eine pflanzliche Komponente, die durch Mazeration im Destillat oder als Extrakt dem Anreichern dient. Früchte und Beeren, Kräuter und Blumen, Gewürze und Wurzeln aller Art eignen sich. Sogar Nüsse, Holz und andere natürliche Zutaten können dem Aromatisieren von Gin dienen. Es gibt Rezepte, bei denen drei bis fünf Botanicals ausreichen. Andere Produzenten bevorzugen über 20, 30 oder noch mehr Zutaten. Die meisten Hersteller verlassen sich auf bis zu zehn Klassiker wie Koriander, Zimt, Iriswurzel, Zitronen- und Orangenschalen und Angelikawurzel. Manche Produzenten setzen auf eine ganz besondere Zutat oder eine große Anzahl an Botanicals, um sich von der Masse abzuheben. In anderen Fällen ist der Betrieb auf eine regionaltypische Prägung aus und legt bei das Hauptaugenmerk auf Pflanzen aus der Region. Spielen diese Botanicals im Aroma und im Geschmack die Hauptrolle, spricht man von New Western Dry Gin.
Wie schmeckt Gin?
Eine einzig richtige Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Sicherlich zieht sich die Wacholdernote von Pinie wie ein roter Faden durch die Spirituosenkategorie, aber sie kann mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und wird generell durch weitere Töne ergänzt. Im Laufe der Zeit haben sich Unterkategorien wie der London Dry Gin mit seinen Herstellungsvorschriften, der süßliche Old Tom Gin und der Sloe Gin (Schlehengin) mit roter Farbe herausgebildet. Letzterer ist genau genommen ein Ginlikör und unterscheidet sich von der Masse, weil er mit Schlehenbeeren verfeinert wird. Abgesehen von solchen Ginsorten hat sich noch ein innovativer Trendsetter herausgebildet: Mehr und mehr Ginmarken ergänzen ihr Sortiment durch alkoholfreie Destillate als Gin-Ersatz. Eine solche Gin-Alternative kommt ohne Alkohol aus und stützt sich lediglich auf die raffiniert destillierten Aromastoffe. Alkoholfreier Gin wird geschmacklich an seine Vorbilder angepasst.
Gönnt man sich klassischen Dry Gin, wird man in erster Linie Wacholderbeeren bemerken. Etwas Waldiges bis Erdiges zeichnet sie aus. Fast jeder deutsche Gin und seine Wettbewerber offenbaren zudem einen Beiklang von Zitrus. Diese frische, feinherbe Zitrusnote stammt nicht immer (nur) von Zitrone und Orange, zwei Hauptzutaten bei der Herstellung. Sie ist oft (auch) auf die Koriandersamen zurückzuführen. Je nachdem, welche Botanicals zum Einsatz kamen, kann ein internationaler oder deutscher Gin sich eher würzig, eher fruchtig, eher herbal mit Kräuternoten, eher mild oder eher stark, eher lieblich oder eher komplex präsentieren. Es ist daher vor dem Gin kaufen sinnvoll, einen Blick auf die Produktbeschreibung und/oder die Zutaten zu werfen. Bestimmte Ginarten sind - wie bereits erwähnt - an der Produktbezeichnung erkennbar. Der Geschmack und das Aroma lassen sich gekonnt betonen oder leicht verändern, wenn man Cocktails und Longdrinks mixt. Ein Beispiel dafür ist der G&T.
Was ist Gin Tonic?
Als der Klassiker schlechthin unter den Longdrinks und Cocktails mit Gin wurde der Gin & Tonic von den Briten erfunden. Er umfasst Anteile an Wacholderschnaps und Tonic-Wasser, normalerweise durch Chinin bitter gemacht und mit Kohlensäure versetzt. Diese Bitterlimonade kommt als Filler zum Einsatz und genau das macht den Longdrink so spannend. Je nach dem Charakter des verwendeten (alkoholfreien) Tonic Waters bringt man andere Charakteristika der Spirituose zur Geltung. Ein einzig richtiges Gin Tonic Rezept gibt es ohnehin nicht. Man kann sowohl beim Tonic mit mehr oder weniger Bitterkeit oder gewissen Geschmacksnoten als auch beim Garnieren und Servieren ‒ z. B. mit Gurke statt mit Zitrone oder Limette ‒ der Kreativität freien Lauf lassen.
Übrigens gibt es nicht nur Unterschiede im Aroma und Geschmack, sondern auch beim Alkoholgehalt und beim Aussehen. Vorgeschrieben für Wacholderschnaps ist ein Mindestalkoholgehalt von 37,5 % vol. Die Trinkstärke liegt aber im Regelfall bei mehr als 40 Volumenprozent. In seltenen Fällen ist sie sogar höher als 50 % vol. Was die Farbe angeht, so ist traditioneller Gin klar. Das hängt mit seiner Destillation zusammen und ist mit Vodka vergleichbar. Eine Ausnahme stellt Reserve Gin dar, teilweise als Barrel Aged oder Cask Aged Gin bezeichnet. Hier hat eine kurze Lagerung in Holzfässern dazu geführt, dass die Spirituose eine helle Farbe von Gelb bis Gold angenommen hat. Ebenso gibt es grünen, blauen, violetten, roten, orangen oder gelben Wacholderschnaps zu entdecken. Er verdankt seine Farbe meist einer besonderen Zutat wie einer färbenden Blüte oder Frucht. Das Paradebeispiel hierfür ist der im Trend liegenden Pink Gin in Rosa, der häufig auf rote Früchte wie Beeren zurückgreift.
Gin: klassisch pur oder gemixt
An Herstellern mangelt es nicht, sodass beim Onlinekauf eine riesige Auswahl darauf wartet, entdeckt zu werden. Zu den ganz Großen gehören u. a. Beefeater, Haymans, Tanqueray und Bombay Gin. Viel Aufmerksamkeit erregen außerdem die Ginsorten von G-Vine, Gordon's, Hendricks und Finsbury. Für etwas Spezielles empfehlen sich gefeierte Geheimtipps wie der Saffron Gin, The Botanist oder Whitley Neill. Je hochwertiger eine Abfüllung ist oder je spezieller der Charakter, desto mehr bietet sich der pure Genuss an. Will man Gin richtig trinken, empfiehlt sich hingegen allgemein das Mixen von Drinks. Neben dem Gin Tonic bieten sich vor allem Cocktails wie Negroni, Gin Fizz, Martini, Tom Collins, Gimlet, Bramble und French 75 an.